Geschichte und Geschichten
aus
Gießhübel im Adlergebirge
aufgeschrieben
von Josef Wondrejz
Vorwort
Josef Wondrejz war mein Großvater. Er wurde am 22. Januar 1897 in Gießhübel im Adlergebirge als Sohn des Webers Josef Wondrejz und der Theresia Wondrejz, geb. Herzig, geboren. Sein Vater war der Bleich Seffe und so wurde mein Großvater Josef der "Bleich-Seffla" genannt.
Nach der Schule arbeitete Josef als Landwirt und 1927 heiratete er die damals 23jährige Schuhmachertochter Rosa Hartmann. Sie hatten vier Töchter: Helga, Rosel, Gerda und Ingrid, von denen letztere meine Mutter ist.
Nach dem zweiten Weltkrieg wurde die deutsche Familie Josef Wondrejz - wie so viele - aus dem Sudetenland vertrieben. Sie landete in Mecklenburg. Josef war zu dieser Zeit noch in russischer Kriegsgefangenschaft und kehrte erst 1947 zu seinen fünf Frauen zurück. Zunächst arbeitete er in Niendorf bei Schönberg bei einem Bauern und später im Holztransportkontor.
In den 60er Jahren schrieb er das Folgende auf. Es wurde leider nie vollständig, denn am 9. Februar 1969 starb mein Großvater. Was blieb sind seine Erinnerungen an seine alte Heimat in Gießhübel.
Zunächst bewahrte meine Großmutter die Aufzeichnungen auf und hegte sie wie einen Schatz, den sie mir als kleinem Kind auch manchmal zeigte. Nach ihrem Tode 1979 ging alles in die Hände von Tochter Gerda. Später übernahm dann meine Tante Helga die Schriften. Sie war es letztendlich auch, die nun nach mehr als dreißig Jahren nach der letzten Niederschrift mich und meine Mutter Ingrid, die jüngste Tochter Josefs, gebeten hat, diese Zeilen endlich einmal so zu Papier zu bringen, dass jeder sie lesen kann, denn mein Großvater schrieb noch in deutscher Schrift (Sütterlin). So musste meine Mutter, die diese Schrift auch noch lesen kann, mir jeden Satz diktieren, damit ich ihn aufschreiben konnte. Das Ergebnis dieser Arbeit sind die folgenden Seiten und ich hoffe, dass das Lesen dieser Zeilen Freude macht und so manches ans Tageslicht bringt, was man vielleicht nicht mehr oder noch nicht wusste.
Anke Wyskupaitis
Im Jahre 1926 schrieb die Fachlehrerin, Fräulein Maria Raabe, in Heimatkunde im dritten Jahrgang der Bürgerschule zu Gießhübel im Adlergebirge vor ihre Aufzeichnungen der Heimat den Satz:
"Eine Aufforderung sollen die Blätter enthalten, unentwegt in Glück und Leid, in Freud und Not an der Heimat festzuhalten."
Seitdem sind mehr als vierzig Jahre vergangen. Groß waren die Ereignisse dieser Zeit. Hunderte starben frühzeitig, mehr als 1000 Menschen mussten die Heimat Gießhübel verlassen. Wer aber kennt heute noch die Vergangenheit der alten Heimat? Deshalb sollen diese Zeilen ein Versuch sein, jenes festzuhalten, was uns aus der alten Heimat noch bekannt ist.
Über die Gründung Gießhübels und die Suche nach Gold
Wann Gießhübel gegründet wurde ist unbekannt. Man schätzt die Zeit um das Jahr 1000, die Gründung dürfte aber noch vor dieser Zeit liegen. Der Sage nach wurde Gießhübel von Venezianern gegründet. Als Venedig in der Zeit seiner Blüte stand, sollen Männer von dort am Ostabhange der "Hohen Mense" erfolgreich nach Gold gegraben haben. Heute noch kann man daselbst Erdlöcher mit Stufenwerk finden, welche in Volkes Munde "Der Goldene Stollen" genannt wurden. Das aus dem Inneren des Berges entnommene Erdreich wurde am Fuße der "Hohen Mense", im Wasser des Baches gewaschen. Das Wasser nannte der Volksmund immer "Der Gießhübler Goldbach". Das Erdreich wurde auf Schubkarren oder Hocken zu Tale getragen. Mit dem hier gewonnenen Golde soll die Marcus-Kirche in Venedig vergoldet worden sein.
Auch bei erfolgreicher Suche konnte man vom Golde allein nicht leben, man brauchte Unterkünfte. So baute man sich aus Baumstämmen Hütten, um einigermaßen leben zu können. So entstand am Fuße der "Hohen Mense", im "Goldbachtale", eine Siedlung, wo noch heute unsere alte Heimat Gießhübel steht. War auch bei der Gründung von Gießhübel die Goldwäscherei der einzige Erwerbszweig, so waren die Einwohner jedoch bald gezwungen, sich um eine andere Erwerbsmöglichkeit umzusehen. Vor allem im Winter war der Weg zum "Goldenen Stollen" oft unmöglich. Da ausgedehnte Wälder die Siedlung umgaben, fertigte man von allem im Winter Löffel, Teller, Tassen und anderes aus Holz an und brachte diese Waren auf Karren und Hocken, später auch auf Wagen, ausschließlich nach Breslau, das im Volksmunde Brasel genannt wurde. Diese Artikel waren in Breslau sehr begehrt, und bald entwickelte sich zwischen Breslau und Gießhübel ein reger Handel. Am Rückwege brachte man vor allem Lebensmittel und andere Bedarfsgegenstände nach Gießhübel mit.
Von der Eisenzeit zur Eisenindustrie
Bald aber war für die Goldgräber ein neuer Erwerbszweig gefunden worden. Wahrscheinlich versuchten sie nicht nur am Ostabhang der "Hohen Mense" ihr Glück, sondern auch an anderen Stellen des Gebirges. So auch im "Grenzwalde", unweit des "Schwarzen Kreuzes". Sie fanden aber kein Gold, sondern reines Eisenerz. Heute noch kann man daselbst die so genannten Erzlöcher sehen, wo einst das Erz gefunden wurde. Dieses dürfte um das Jahr 1000 gewesen sein. Da der Wert des Eisens in jener Zeit von Jahr zu Jahr stieg, baute der damalige Grundbesitzer am Westabhange des "Dinterhügels" eine Eisenschmelze. Später wurde daraus auch eine Eisengießerei. Aber nicht nur in Gießhübel entstand eine Eisenschmelze, auch in Hinterkohlaubei Reinerz erinnerten zwei Restaurants an eine kleine und eine große Schmelze. Da die Erzlöcher in der Mitte dieser drei Schmelzen lagen, ist es sicher, dass alle drei Schmelzen einem Besitzer gehörten. Dieser wohnte sicher in Reinerz. Auch Reinerz dürfte seinen Namen von diesem Eisenerzfund erhalten haben.
Das Eisenerz wurde auf Karren und Wagen über den "Pansker" nach Gießhübel und in entgegen gesetzter Richtung nach Hinterkohlau gebracht. Die Erzeugnisse dieser drei Schmelzen aber gingen ausschließlich nach Schlesien, vor allem nach Breslau. In Gießhübel wurden in erster Zeit nur Nägel geschmiedet. Diese Nägel waren in Schlesien sehr begehrt. Vor allem zum Bau der Holzhäuser wurden sie verwendet. Die Schmiedung dieser Nägel geschah in Gießhübel abseits der Wohnhäuser. Heute noch kennt der Volksmund das "Nagelhüttental". Da zum Schmieden der Nägel Holzkohle gebraucht wurde, findet man nicht weit vom "Nagelhüttental" den "Kohlgraben". Hier standen Kohlmeiler und lieferten die Holzkohle der Schmelze und den Schmieden.
Trotz des Dreißigjährigen Krieges und der Zerstörung der Frimburg 1639 und trotz Pest und Cholera stand die Eisengießerei in Gießhübel im 17. Jahrhundert in ihrer Blüte. Nicht nur Nägel wurden geschmiedet, auch Töpfe, Pfannen, Ofentöpfe und andere Sachen wurden gegossen. Drei dieser Ofentöpfe sind heute noch vorhanden: einer in der Pfarrei trägt die Aufschrift: "1680 Adam B.", ein anderer: "Gießhübel 1665" und ein dritter: "Im Jahre des Herrn 1682". Außer diesen Eisengießereien und Eisenschmieden in den Nagelhütten stand in Untergießhübel beim Hause Nr. 45 ein Eisenhammer. Eisenschmelze und Eisenhammer wurden mit Wasser betrieben. In Obergießhübel, beim "Dinterhügel" und in Untergießhübel bei Nr. 44 wurden Teiche angelegt, die aber später, nach dem Ende dieses Erwerbszweiges, wieder in Wiesengrund verwandelt wurden. In dieser Zeit hatte Gießhübel einen starken Zuzug von Familien zu verzeichnen. Viele neue Häuser wurden gebaut, vor allem bei der Schmelze, im heutigen Buschdörfel. Die Häuser wurden nur aus Holz gebaut.
In der Zeit von 1685 bis 1700 ging diese schwunghafte Eisenindustrie in Gießhübel plötzlich ein. Die Ursache wurde zwar nicht verbrieft, doch in einer Urkunde von Kaiser Josef I. aus dem Jahre 1706 steht geschrieben, dass Gießhübel durch Durchmarsch, Einquartierung und Contribution unserer kaiserlichen Soldateska stark gelitten hat und in große Armut geraten ist. In dieser Zeit hat Preußen Schlesien und die Grafschaft Glatz annektiert, und aus der Landesgrenze Böhmen Grafschaft Glatz wurde eine Staatsgrenze. Da die Erzlöcher nur wenige Meter von dieser Staatsgrenze entfernt waren, musste die Förderung eingestellt werden. Gießhübel aber verlor nicht nur die Eisenindustrie, sondern auch seinen Grundherren. In dieser Zeit musste die Herrschaft Coloredo von und zu Opocno die Herrschaft Frimburg übernehmen.
Der Burgenbau um Gießhübel
Als die Eisenindustrie dem Volke gute Arbeit brachte, dachte der Grundherr auch an seinen Anteil. Robot musste geleistet werden. Der einzige in einer Urkunde des Prager Erzbistums aus dem Jahre 1354 bekannte Grundherr von Gießhübel hieß Mathias von Frimburg. Aber schon seine Vorfahren hatten an die Sicherheit der Gießhübler Eisenindustrie gedacht. In Robott ließen sie drei Burgen bauen: die Hummelburg, nur ca. einen Kilometer von den Erzlöchern entfernt gegen Nordosten, eine zweite bei Lewin gegen Nordwesten, die Hradischburg, und die größte, für eigenen Bedarf des Grundherrn ca. eine Stunde von Gießhübel entfernt gegen Westen, die Frimburg. Man schätzt die Bauzeit dieser drei Burgen vom 9. bis 12. Jahrhundert.
Auf unzugänglichem, steilem, ca. 200 Meter hohem Berge, im Tale des "Gießhübler Goldbaches", steht heute noch die sehr gut erhaltene Ruine der einst stolzen Frimburg. Nur von Osten her, also von Gießhübel her, war sie zugänglich. Aber auch hier war sie durch doppelte Wälle gesichert. Die Burg selbst bestand aus einer unteren und einer oberen Burg. Gegen Osten, hinter den Wällen, war ein starker, ca. 20 Meter hoher Turm mit Brunnen. Die untere Burg hatte Wirtschaftsräume und Dienerwohnungen, die obere Burg nur Herrschaftswohnungen. Der einzige, uns bekannte Besitzer, war Mathias von Frimburg, der als Patronatsherr Gießhübel 1354 einen Pfarrer gab.
Auf einem kegelförmigen Berge bei dem heutigen Städtchen Lewin war eine zweite Burg gebaut worden, die so genannte Hradischburg. Diese diente dem Schutz gegen eindringendes Gesindel aus dem Inneren Böhmens über Nachod gegen Glatz.
Die dritte Burg gegen Nordosten, die Hummelburg, wurde erbaut zum Schutze gegen eindringende Polen und andere Kriegsherren.
Blick auf den Hummel
Alle drei Burgen konnten auf unterirdischen Gängen erreicht und verlassen werden. Erbaut wurden alle aus Schiefersteinen. Wie heute noch auf der Ruine Frimburg zu sehen ist, waren alle Wände 60 cm stark. Da aber Schieferstein nur auf halbem Wege zwischen Gießhübel und der Frimburg zu finden ist, musste der Stein von hier aus, also vom heutigen Dlohei oder dem "Hofeberge" aus Gießhübel, zum Bau der Burgen transportiert worden sein. Diese Arbeit ist meistens von Gießhübler Arbeitern in Robott geleistet worden. Der Kalk zum Bau dieser Burgen wurde ausschließlich in Obergießhübel bei der "Schnappe" genommen. Heute noch nennt man die Wiesen gegenüber der "Schnappe", die Kalkwiesen.
Von allen drei Burgen konnte die Frimburg am längsten den anstürmenden Kriegsherren widerstehen. Erst im heißen Sommer des Jahres 1639 gelang es einem schwedischen Kriegsherren, von Nachod kommend, wo er das Schloss wochenlang vergebens gestürmt hatte, die Frimburg zu stürmen und zu plündern. Von hier aus zogen sie nach Gießhübel weiter, wo kein Haus und kein Mensch von den Schweden verschont wurde. Die meisten Menschen waren in die Wälder geflohen, und manche Mutter flehte zu ihrem Kind: "Kind, Kind bet`, morgen kommt der Schwed`".
Ein Teil der Häuser war in Flammen aufgegangen. Dann zogen sie über den "Pansker", dem damals einzigen Weg nach Osten, weiter. Beim "Schwarzen Kreuz" stellte sich ihnen eine bewaffnete Schar von Männern entgegen, eine kurze Schlacht, die Schweden siegten zwar, aber ihr Anführer fiel. Fern von der Heimat legten die Schweden ihn ins Grab und setzten ihm ein steinernes Kreuz, das heute noch "Das Schwedenkreuz" genannt wird.
Das "Kreuzstainla" (1968)
Als 1415 Hus in Konstanz am Bodensee verbrannt worden war, zogen die Hussiten, von Prag aus, plündernd durch das ganze Land. Auch Gießhübel wurde von ihnen nicht verschont. Unter dem Befehl des gefürchteten Hussitenführers, Peter Polak, drangen bewaffnete Banden von Nachod aus in das deutsche Gebirgsland des Hummelpasses. Nach hartem, furchtbarem Kampfe gelang es Peter Polak, das Hummelschloss zu stürmen. Dies geschah 1427. Von hier aus zog er plündernd durch das Land, wobei ihm auch die Kirche von Gießhübel zum Opfer fiel. Erst 1433 gelang es, Peter Polak zu besiegen und ihn gefangen zu nehmen.
Bereits 1428 gelang es auch den Hussiten die Hradischburg zu stürmen, nachdem die Verteidiger ein Jahr lang jedem Ansturm widerstanden hatten. Als den Verteidigern die Lebensmittel ausgegangen waren, entschlossen sie sich zur Aufgabe der Burg. Man ließ Licht brennen und verließ auf einem unterirdischen Gang bei Nacht die Burg. In einem Buchenwäldchen westwärts der Burg verließ man den Gang und wandte sich schnell, um von den Hussiten nicht bemerkt zu werden, der Schwesterburg, Frimburg zu. Dort fand man Aufnahme und Schutz. Als die Hussiten merkten, dass die Burg verlassen war, plünderten sie alles und zerstörten die Burg, so dass man heute noch kaum Mauerreste sehen kann. Da die Verteidiger der Burg auch nicht immer auf der Frimburg bleiben konnten, die Hradischburg aber nicht neu erbaut werden konnte, bauten sie sich vor der Frimburg Hütten und Häuser und nannten die Siedlung Neu Hradisch, zur Erinnerung an die alte Heimat. Später wurde daraus das heutige Novi Hradek.
Nach der Gefangennahme Peter Polaks wurde die Hummelburg keine Friedensburg mehr, sondern eine Raubfeste. Der schwerste Raubritter war Siegmund von Kaufungen, der am 24. Mai 1534 nach blutigen Kämpfen gefangen genommen und in Wien wegen seiner schweren Verbrechen hingerichtet wurde. Die Burg aber wurde abgebrochen, damit sie auch als Räuberhöhle verschwand. Mauerreste des Turmes sind heute alles, was von einst übrig blieb.
In Robot wurden nicht nur die drei Burgen gebaut
Aber nicht nur diese drei Burgen mussten von den Einwohnern Gießhübels dem Grundherren in Robot gebaut werden, sondern vor allem noch ein Jagdschlösschen, das heute noch in seinen Grundmauern besteht, das Haus Nr. 1 in der Stadtabteilung, das im Volksmunde das Rathaus genannt wird.
Das alte Rathaus
Zwar fiel auch dieses Schlösschen einem Großbrande im Jahre 1861 zum Opfer, doch die aus Schieferstein erbauten Grundmauern blieben stehen, so dass es bereits 1862 wieder aufgebaut wurde, aber der Turm in der Mitte mit einer Turmuhr entstand nicht wieder. Bis um 1700 diente es dem Grundherrn als Jagdschloss. Als um 1700 der Grundherr vertrieben wurde, diente es der Gemeinde als Rathaus. Bis in das 20. Jahrhundert war es für die Einwohner das Rathaus. Als solches hatte es auch einen Ratskeller. Dieser Ratskeller wurde in der Regel auf 6 Jahre verpachtet. Der letzte Pächter war ein Oberkommissar i. R. Rotter, der seine Pension mit seiner Familie, einer Frau und sechs Töchtern, hier verlebte. War bisher das Geschäft immer gut, brachte doch der erste Weltkrieg ein plötzliches Ende. Die Pacht wurde 1916 nicht erneuert und das Gewerbe als "ruhend" gemeldet. Als nach 10 Jahren der Hotelbesitzer Franz Jirku Bürgermeister von Gießhübel war, ließ dieser aus Konkurrenzgründen trotz dreimaliger Aufforderung seitens der Bezirkshauptmannschaft Neustadt an der Mettau das Gewerbe verfallen, ohne auch nur einmal die Gemeindevertretung zu verständigen.
Vor dem Pächter Rotter war durch lange Jahre Zachranik Pächter des Ratskellers, der durch Heirat auch das Haus Nr. 56 in Untergießhübel erworben hatte. Er war seit Gründung des Veteranenvereins dessen Kommandant, so dass jährlich ein Veteranenball im Ratskeller abgehalten wurde.
Bis zum Jahr 1938 diente dieses Haus der Gemeinde als Rathaus, dieses wurde aber dann, als Josef Schmoranz Bürgermeister von Gießhübel wurde in das Haus Nr. 11 verlegt. Seit der Eröffnung eines Zollamtes in Gießhübel war dieses auch im Rathaus untergebracht.
Aber nicht nur das Jagdschlösschen musste in Robot gebaut werden, der Bau der Schmelzen war selbstverständlich eine Robottarbeit der Einwohner von Gießhübel. Auch der Eisenhammer in Untergießhübel, wie auch der Hammerhof wurde in Robotarbeit von Gießhüblern erbaut. Die heute noch sichtbaren Mauerarbeiten vom ehemaligen Hammerhof, gleichen genau den Bauarbeiten der Ruine Frimburg, aber auch der Bauweise des Gießhübler Jagdschlösschens, auch dem der ehemaligen Schmelze. Als 1639 die Schweden die Frimburg gestürmt und geplündert hatten, bemächtigte sich der Ritter Trtschka der Frimburg und in Gießhübel des Hammerhofes. Er war ein Heerführer des Dreißigjährigen Krieges, wahrscheinlich unter Wallenstein, und brachte auch seine Leute mit. Unter ihm wurde ein Evangelischer Richter von Gießhübel. Er hieß Georg Hofman und amtierte von 1640 bis 1651. Aber beim Durchmarsch von kaiserlichen Truppen vor den Jahre 1700 wurde auch Trtschka mit seinen Leuten wieder aus Gießhübel vertrieben, und sie flohen ostwärts ins Gebirge, wo sie ein neues Dorf gründeten, das heute noch Trtschkadorf heißt.
Der Hammerhof, wie auch der Eisenhammer wurden vollständig zerstört, der Besitz, die "Hofewiesen" und der "Hofeberg" wurden parzelliert und an die Einwohner von Gießhübel verkauft, natürlich gegen Zahlung einer jährlichen Robot. Nur zwei Teile konnten nicht verkauft werden, der Teich am Hause Nr. 44 und die "Wölfei". Die Herrschaft Coloredo auf Opocno wurde gezwungen, diese beiden Grundstücke zu übernehmen. Erst nach 1918 bei der Bodenreform des neuen tschechoslowakischen Staates wurde der Teich, der inzwischen in Wiesengrund umgewandelt war und vom Bauern Linke in Untergießhübel gepachtet war, in drei Teile geteilt und an Klampta, Stepan Kaufmann und Josef Zeipelt verkauft.
Die "Wölfei" aber wurde trotz Einspruchs der Gemeinde an den Großindustriellen Barton aus Nachod zum Preise von 5 Hellern pro gepflanztes Bäumchen verkauft.
1945 wurde auch dieser, als deutscher
Besitz, beschlagnahmt und verstaatlicht. Auf den Ruinen des Hammerhofes wurde
Anfang des 20. Jahrhunderts das Bauernhaus Nr. 42 erbaut.
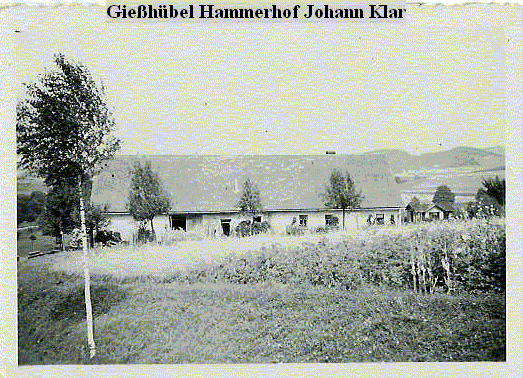
Außer den bereits genannten dürften in der damaligen Zeit noch zwei Häuser in Gießhübel in Robot gebaut worden sein. Es sind dieselben Steinhaufen wie das Jagdschlösschen.
Es handelt sich hierbei um das "Hegerhaus" in Obergießhübel gegenüber der "Schnappe", das als Unterkunft einst für den Kalkbrenner gebaut wurde, da nicht weit davon ein Kalkofen stand, heute sind es die Kalkwiesen. Das zweite Haus ist das ehemalige Gasthaus "Zur Krone" an der scharfen Ecke im Stadtla. Die Mauerreste gleichen genau der Bauart des Jagdschlösschens.
Gasthaus "Zur Krone" (1988)
Die Leinenweber kommen nach Gießhübel
Als vor dem Jahre 1700 die schwunghafte Eisenindustrie plötzlich eingegangen war, weil die Gemeinde wegen des Durchzugs von Kriegsherren ganz verarmt war, kamen durch Vermittlung des Grafen Hieronymus von und zu Coloredo auf Opocno fünf Familien nach Gießhübel, die der Bevölkerung einen neuen Erwerbszweig, die Leinenweberei, beibringen sollten. Die Namen der fünf Familien waren: Stonner, Stonjek, Schramm, Schmoranz und Wondrejz. Wo diese Familien herkamen, ist umstritten.
Jedenfalls aber waren sie keine Tschechen. Es gab zum Beispiel trotz starker Tschechisierung ab 1918 bis 1945 keine Familie Wondrejz, die tschechisch als Haussprache benützt hätte. Bald nach dem Eintreffen der fünf Familien in Gießhübel finden wir, dass sich die Familie Wondrejz mehr dem Lehr- und Handelsgewerbe zugewandt hat, während die anderen vier Familien sich dem Organisatorischen zuwandten. Während wir schon 1700 einen Johann Stonjek als Richter von Gießhübel finden, ist ein Mathias Wondrejz, geboren 1696, bis 1772 Lehrer in Gießhübel. Auf einem alten Grabstein am Friedhof von Gießhübel konnte man lesen: "Ignatz Wondrejz, Lehrer und Handelsmann durch 52 Jahre in Gießhübel". Auch von einem Prokop Wondrejz wissen wir, dass er noch um 1850 von Gießhübel mit Schubkarren bis Brünn und Wien gefahren ist, fertige Ware abzuliefern und neue Arbeit mitzubringen. Auch die Bleiche in Obergießhübel gehörte einer Wondrejz- Familie, woraus man sehen kann, dass die Familie Wondrejz von Anfang an Lehr- und Handelsgeschäfte erledigte, während die anderen vier Familien Webstühle bauten und herrichteten. Bald sah die Gemeinde in der Handweberei ein ehrsames Gewerbe und in jedem Hause klapperte ein Webstuhl, oft sogar zwei, da auch jeder seine Kinder mit zur Arbeit heranzog. Es gab bald viel Arbeit, da nicht nur gewebt wurde. In keinem Hause fehlte ein Spinnrad. Es wurde auch Flachs angebaut. Brechhäuser zur Verarbeitung des Flachses entstanden. Auch stand öfter mal eines in Flammen, aber die Gemeinde hatte wieder Verdienst, wenn auch nur kargen.
Um etwas mehr zu verdienen, versuchte die Hausiererin Elisabeth Stonner, Schwester des Ratsmannes Josef Stonner aus Untergießhübel, die von ihr gewebten Leinen auch selbst zu verkaufen. Bis Königgrätz, Josefstadt und Jaromer trug sie diese um etwas mehr Geld zu bekommen. Im Herbst 1799 nahm sie einmal ihre Nichte Magdalena Stonner mit. Beide waren gegen 9:00 Uhr schon vor Josefstadt, zogen sich ihre Schuhe auf einem Holzplatz an, bis dahin waren sie barfuss gelaufen, da bemerkten sie einen Mann, der sie beobachtete und auf sie zukam. Sie erzählten ihm bereitwillig, was sie tun und was sie hierher bringen. Als sie sagten, dass sie schon aus Gießhübel kommen, gab der Mann der Magdalena einen Silbertaler, der Hausiererin einen Zettel, mit welchem sie zur Heeresakademie gehen sollten. Dort kaufte man ihnen sämtliche Leinen ab und bezahlte sie gut. Als der Mann aber von ihnen wegging, sagte er nur noch: "Wenn ihr wieder nach Gießhübel kommt, dann sagt dort, dass ihr mit Kaiser Josef gesprochen habt!". Da war ihre Freude groß, aber in Gießhübel wollte man ihnen das nicht glauben.
Die Baumwollweberei verdrängt die Leinenweberei
Rund hundert Jahre hat die Leinenweberei Gießhübel ernährt, dann aber verdrängte die Baumwollweberei sie. Bis aus Brünn und Wien holten Handelsleute nun Arbeit, und lieferten dorthin fertige Ware ab. Vielleicht bis zu zweihundert Handwebstühle klapperten in dieser Zeit in Gießhübel. Aber um das Jahr 1880 begann die mechanische Erzeugung von Baumwollwaren die Handarbeit zu verdrängen. Als erster richtete ein Herr Adolf Soumar, der von Mesilei auf einem Pferde geritten nach Gießhübel kam, eine mit Wasser betriebene mechanische Baumwollweberei ein. Durch Heirat erwarb er die so genannte Netikmühle, legte diese still und gründete die erste Baumwollfabrik. Mit der Zeit klapperten hier ca. 30 Webstühle, und mancher als Weber fand nun hier seinen Verdienst. Auch Handweber fanden bei Soumar Arbeit, so dass er bald als "König von Gießhübel" angesehen wurde.
Weberei Soumar (um 1900)
Das Beispiel seiner Mechanisierung der Baumwollerzeugung machte bald Schule, und vor allem in Obergießhübel. Aus der Schintagmühle wurde eine mechanische Weberei, wenn auch nur von sechs bis acht Webstühlen. Dann wurden aus der Vogelmühle durch Anton Czerny und aus der Czernymühle durch Josef Czerny mechanische Webereien. Die größte mechanische Weberei von Gießhübel aber entstand aus der Kinzelmühle in Untergießhübel im Jahre 1920. Hier gaben gegen 70 Webstühle den Menschen Verdienst. Diese wurden von Anton Marik gebaut, aber bald gerichtlich verkauft an einen Semerak aus Rotkostelez.
Kinzelmühle (1920)
Auch die Soumarweberei wurde 1930 gerichtlich verkauft. Bubinicek war Käufer, aber dieser, wie auch ein Stwrtetschka aus Dlohei, der in Gießhübel auch eine Weberei betrieb, stellten ihre Erzeugung ein, als Hitler seine Hand 1938 auch auf Gießhübel legte. Nach 1938 ließ jede Erzeugung der Baumwollweberei stark nach, und 1945 kam alles ganz zum Erliegen.
Gießhübel hatte viele Namen
Wann der Ort Gießhübel den Namen erhielt, ist umstritten. Tschechen behaupten heute, erst im Jahre 1405. Aber bereits im Jahre 1354 in einer Urkunde des Prager Erzbistums heißt der Ort Gießhübel. Den Namen erhielt Gießhübel durch die Eisengießerei, die auf einem Hügel stand, also Gießhübel. In einer Urkunde von Kaiser Josef I. aus dem Jahre 1706 nannte dieser Gießhübel: "Das Städtlein Teutsch Gießhübel", was nach heutiger Rechtschreibung: "Deutsch Gießhübel" heißen müsste. Also 1706 war Gießhübel schon ein Städtchen und hatte als solches eigene Gerichtsbarkeit. Nach der Einteilung Böhmens in Bezirke um 1850 kam Gießhübel zum Bezirk Neustadt an der Mettau, und bekam den amtlichen Namen: "Gießhübel bei Neustadt an der Mettau". 1922 erhielt Gießhübel den amtlichen Namen: "Gießhübel im Adlergebirge", welcher bis 1945 blieb. Tschechisch nannte man Gießhübel: "Olenice". Diesen tschechischen Namen erhielt Gießhübel amtlich nach der Gründung der Tschechoslowakei 1918. Aber schon ca. 15 Jahre früher war der Name Olenice aufgetaucht. In Nachod, Opocno und Dobruka nannte man den Ort auch tschechisch: "Gießhüblu". Anders war es in Neustadt. Hier saß die tschechische Jednota, geführt von einem Dr. Wenzel Swoboda von der Bezirkshauptmannschaft in Neustadt an der Mettau, und dieser versuchte schon um 1900 Gießhübel zu tschechisieren. Schon 1906 erhielt der "Gießhübler Goldbach" den amtlichen deutschen Namen: "Alscherbach", tschechisch aber nannte man ihn: "Oleenka", ungefähr wie "Erlenbach". Da aber ein "Erlenwasser" nicht aus einem Gießhübel kommen konnte, nannte man Gießhübel: "Olenice", zwar nicht amtlich, da dies zu jener Zeit noch nicht möglich war, aber so nebenbei. Um den Namen aber bekannt zu machen, schritt man zur List. Der Tscheche Wendelin Zeuner, Sohn einer Mischehe aus Gießhübel tschechische Mutter und deutscher Vater war Postkutscher in Gießhübel. Im Jahre 1906 hat man diesen in Neustadt betrunken gemacht es waren Vertreter der Bezirks- und der Postverwaltung - und schrieb auf seine Postkutsche rechts den Namen Gießhübel, links aber Olenice. Nachmittags fuhr Zeuner galoppierend, in sein Posthorn blasend, in Gießhübel ein. In Untergießhübel zerbrach ihm ein Hinterrad seiner Postkutsche und deutsche Männer mussten ihm helfen, weiterzukommen. Das war die Taufe für das tschechische Olenice. Da von deutscher Seite kein Einspruch gegen dieses Vorgehen der Tschechen erfolgte, blieb es bei dieser Bezeichnung der Postkutsche. Wendelin Zeuner aber wurde so zum Helden der Tschechisierer von Gießhübel und Held der tschechischen Nation, was man noch 1950 an seinem Sterbebette erleben konnte. So führte der Ort ab 1918 amtlich den tschechischen Namen Olenice und den deutschen Namen Gießhübel bis 1938, wo es dann nur Gießhübel hieß, ab 1945 jedoch nur wieder Olenice heißt.
Die Einwohnerzahl schwankte ständig
Nach der Gründung wuchs die Einwohnerzahl von Gießhübel ständig. Besonders der Bau der Burgen, der Schmelze, des Jagdschlösschens und des Hammerhofes beschäftigte viele Menschen. Auch Holzhäuser für die Arbeiter entstanden, besonders in Untergießhübel und am heutigen Ringplatz. Da 1350 schon der Bau einer Holzkirche erwähnt wird, schätzt man die Einwohnerzahl in dieser Zeit schon auf mehr als eintausend Menschen. In der Blütezeit der Eisenindustrie und später der Handweberei entwickelte Gießhübel sich immer mehr und gegen 1890 waren mehr als dreitausend Einwohner in Gießhübel. Da aber begann die Entwicklung zu versagen. Während in der Umgebung große Baumwollwebereien entstanden, hemmte tschechischer Einfluss in Gießhübel die Entwicklung. Als der Staat in Gießhübel eine Tabakfabrik errichten wollte, stellte sich der Tscheche Soumar, Besitzer einer kleinen mechanischen Weberei in Gießhübel, dagegen, um nicht die billigen Arbeitskräfte zu verlieren, so dass viele Arbeitskräfte in die Umgebung abwanderten, weil sie dort ein besseres Leben führen konnten. Als man noch den Bau einer Eisenbahn nach Gießhübel plante, waren sogar die Bauern von Gießhübel dagegen, weil sie dann nichts zu fahren hätten. So wanderten immer mehr Familien ab, so dass 1918 bei der Gründung der Tschechoslowakei Gießhübel kaum mehr als 1500 Einwohner zählte.
Die ersten Tschechen kommen nach Gießhübel
Vor 1890 gab es in Gießhübel keine Familie, die sich der tschechischen Sprache als Haussprache bedient hätte. Erst um diese Zeit wurde von Amtswegen der Schornsteinfeger Stovicek nach Gießhübel versetzt. Etwas später kam Adolf Soumar und heiratete eine Deutsche, als dritte Familie kam Przibil aus Dlohei nach Obergießhübel. Diese drei tschechischen Familien waren die ersten Tschechen, die in Gießhübel Haus- und Grundbesitz erworben haben. Stovicek und Soumar waren neben Wendelin Zeuner die Helden der Tschechisierung von Gießhübel.
Der Straßenbau in und um Gießhübel
Noch um das Jahr 1900 wäre eine Reise nach Gießhübel mit Autos der Neuzeit unmöglich gewesen. Wohl wurden bald nach der Gründung von Gießhübel Wege angelegt, aber keiner war mehr als drei Ellen breit, also 1,80 m. Der beste und heute noch erhaltene Weg der damaligen Zeit, ist der Weg von heutigen Ringplatz über den "Herzigberg", den "Pansker" zu den Erzlöchern, der auf der anderen Seite bis nach Hinterkohlau führte. Der Brandkalk von den Kalkwiesen wurde auf demselben Wege über Gießhübel, Tassau nach der Frimburg gefahren.
Später, nach 1700, wurde von Gießhübel ein Weg über die "Draha" in Untergießhübel nach Dlohei, Rzy, Tis nach Bodain gelegt. Dieser Weg war bis 1904 die einzige Verbindung mit Neustadt und Dobruka. Bis 1813 war die einzige Verbindung mit Sattel, und von dort weiter über Untergießhübel, durch die "Wölfei". Erst 1813 bauten die Russen einen Knüppeldamm, wo heute der Weg nach Pollom führt. Diese Russen waren mit schwerer Artillerie auf dem Wege zu einer Heeresschau nach Opocno und waren von der Heeresstraße V über Kuttel nach Gießhübel gekommen. Auf den Kuttler Wiesen, zwischen Wolf und Hasler lagerten sie einige Tage, und da sie ihre Geschütze nicht auf dem Weg im "Kuttler Graben" zum Stonjek und durch die "Wölfei" weiterbringen konnten, bauten sie den Knüppeldamm über den "Roten Hügel". Erst um 1900 baute man den Knüppeldamm zu einer besseren Straße aus. 1904 wurde die neue Straße von Rokoli nach Gießhübel gebaut. Nach der Eröffnung eines Zollamtes in Gießhübel wurde ein besserer Zollweg über den "Kirchberg" nach Kuttel gelegt, der aber 1914 bis 1918 durch den Bau einer kurvenreichen Zollstraße stillgelegt wurde. Vor 1900 wurde die Straße durch Obergießhübel bis zum "Schwarzen Kreuz" gebaut, die den Weg über den "Pansker" ersetzte. Eine Straße, die von Neu Hradek nach Nachod gebaut wurde, die in Dlohei auch von Gießhübel erreichbar war, entstand erst nach dem ersten Weltkrieg, so um 1920. In dieser Zeit, also 1920 bis 1923 entstand ebenfalls eine Straße von Rokoli nach Neustadt und war die erste direkte Verbindung von Gießhübel über Rokoli nach Neustadt. Ein schmaler Weg über Deschnei, Reichenau nach Brünn und Wien war zwar sehr alt, aber um 1900 wurde auch dieser verbreitert.
Die Geschichte der Kirche von Gießhübel
Die Ortskirche von Gießhübel war immer der Heiligen Maria Magdalena geweiht. In der heutigen Form wurde sie 1703 bis 1705 erbaut. Doch schon 1350 wird in einer Urkunde der Bau einer Kirche erwähnt. 1354 gibt nach einer Urkunde des Prager Erzbistums der Besitzer der Frimburg, Mathias von Frimburg, als Patronatsherr, der Kirche von Gießhübel einen Pfarrer. Diese Kirche aber dürfte nicht lange gestanden haben. Als 1427 die Hussiten die Hummelburg erstürmten dürfte auch unsere Kirche zerstört worden sein. Nachrichten darüber fehlen. In einer Urkunde aus späterer Zeit kann man lesen: "dass den kommenden Inwohnern des Städtels anzumerken wäre, dass man beim Abbrechen der alten hölzernen Kirche die Jahreszahl "1530 aufgebaut" vorfand". Daraus geht hervor, dass die zweite Kirche bereits im Jahre 1530 gebaut wurde. Eine Glocke aus jener Zeit trug die Jahreszahl 1558 und wog drei Zentner und 66 Pfund. Ob die Kirche einen Pfarrer hatte, ist unbekannt. Doch im Jahre 1702 wurde die baufällig gewordene, hölzerne Kirche niedergerissen und der Bau einer steinernen Kirche begonnen, wie sie in der heutigen Form noch steht.
Kirche Maria Magdalena (2002)
Oberrichter war damals der noch nicht lange nach Gießhübel zugezogene Daniel Hieronymus Stonner von 1704 bis 1725. Der Baumeister war Kaspar Klinkert aus Habelschwerdt. Der Bau wurde 1705 beendet. 1706 begann und beendete man den Bau des Friedhofes. 1707 wurde die Kirche mit einer Orgel versehen. Diese wurde vom Orgelbauer Ferdinand Halbig aus Heidisch bei Grulich aufgestellt. Sie kostete 100 rheinische Gulden. Die steinerne Stiege zur Kirche wurde 1710 erbaut. Das Material dazu schenkte der Gemeinde ein Baron Harlig aus Rückerts.
Magdalenenstiege (1998)
Nach der Zerstörung der Kirche durch die Hussiten 1427 war für Gießhübel eine schwere Zeit, da auch nach der Gefangennahme Peter Polaks die Hummelburg eine Raubfeste blieb. Erst nach der Hinrichtung des gefürchteten Raubritters, Siegmund von Kaufungen, 1534 konnte Gießhübel wieder an den Aufbau denken. Trotz des Baus der Kirche, der 1530 begonnen wurde, blieb Gießhübel seelsorgerisch der Pfarre in Sattel unterstellt. Da in dieser Zeit auch in Sattel eine neue Kirche gebaut worden war, die Gemeinde aber kein entsprechendes Pfarrhaus bauen wollte, bemühte sich Gießhübel um den Sitz des Pfarrers. Mit Bewilligung des Bischofs von Königgrätz und des Herrschaftsbesitzers, dem Grafen Coloredo auf Opocno, wurde laut Urkunde am 18. Oktober 1743 Gießhübel zur Pfarre erhoben. Sattel wurde aber zur Lokalie umgewandelt. Auf wiederholtes Bitten der Sattler Ortsbewohner wurde die Rangerhöhung bereits am 17. Jänner 1750 rückgängig gemacht, aber Gießhübel erhielt einen ständig hier wohnenden Kaplan.
Als am 18. Oktober 1743, in Gießhübel war Kirchweihfest, das Allerheiligste in feierlicher Prozession von Sattel nach Gießhübel getragen wurde, wurde Josef Kittinger Pfarrer von Gießhübel, bis zum Jahre 1747. Nach ihm wurde Franz Riedel Pfarrer von Gießhübel, von 1747 bis 1749. Er starb in Gießhübel am 6. Juli 1749 und liegt in der Kirche begraben. Nach ihm wurde Nikolaus Gindra Pfarrer von Gießhübel, der aber am 17. Januar 1750 nach der Rückgängigmachung der Rangerhöhung, nach Sattel ging. In Gießhübel aber blieben ständige Lokalisten. Der erste Lokalist war Anton Smrkovsky von 1750 bis 1752.
Weitere Lokalisten waren: Josef Rzehak 1752 bis 1755 aus Dobruka
Ignatz Krebs 1755 bis 1758 aus Opocno
Franz Peikert 1758 bis 1766 aus Reichenau
Ignatz Kratochwil 1766 bis 1785 aus Dobruka
Josef Machatschek 1785 bis 1786 aus Chrust
Josef Nutz 1786 bis 1790 aus Reichenau
Wenzel Czeyp 1790 bis 1795 aus Königgrätz
Wenzel Herzig 1791 aus Gießhübel
Den Lokalisten folgten die Administratoren:
Wenzel Schmidbergsky 1795 bis 1798
Mathias Gizkra 1798 bis 1804
Anton Finger 1804 bis 1811 aus Smiritz
Franz Hottisch 1811 bis 1813 aus Opocno
Wenzel Wich 1813
Anton Obst 1813 bis 1817 aus Gießhübel
Anton Przibil 1818 bis 1849 aus Jicin
Auf die Administratoren folgten die Pfarrer:
Wenzel Brandejs 1849 bis 1875 aus Klein Petrowitz
(er wurde am 31. März 1853 zum Pfarrer erhoben)
Ferdinand Hanousek 1875 bis 1898 aus Reichenau
Sebastian Weber 1898 bis 1913 aus Plaßnitz
Wenzel Pleskott 1913 bis 1927 aus Opatowitz
Anton Rouhacek 1927 bis 1934 aus Plumenau
Anton Rührich 1934 bis 1945 aus Mastig.
Das waren die Seelsorger von Gießhübel durch zwei Jahrhunderte, von denen nur noch bekannt ist, dass Weber auf eigenes Verlangen in Gießhübel beerdigt wurde, Rührich 1945 von den Tschechen erschossen wurde und in Slovonov auf dem Friedhof beerdigt wurde. Hanousek wurde 1898 wegen eines Vorfalls nach Hohenbruck strafversetzt (er hatte sich in eine Frau verliebt).
Ein Stadtbrand am 21. Oktober 1861 verschonte auch unsere Kirche nicht. Da das Dach nur mit Schindeln gedeckt war, brannte alles bis auf die Grundmauern nieder. Der Wiederaufbau erfolgte erst 1862 und wurde durch milde Gaben gedeckt. Besonders verdient machte sich ein in Gießhübel geborener Feldkurator aus Wien, Ignatz Rolletschek. Der Gottesdienst wurde in dieser Zeit meistens in einer Bretterbude abgehalten. 1869 wurde eine Orgel gekauft. Sie kostete 700 Gulden. Diese steht heute noch in der Kirche.
Orgel in der Gießhübler Kirche (1937)
Vor dem Brand 1861 hingen zwei große und zwei kleine Glocken im Turm. Die größte wog drei Zentner und 66 Pfund und stammte aus dem Jahre 1558. Beim Brande schmolzen diese Glocken und mussten neu angeschafft werden. Diese wurden wieder im ersten Weltkrieg 1917 abgeliefert. 1926 wurden drei neue Glocken angeschafft, die aber im zweiten Weltkrieg wieder zerschlagen und abgeliefert werden mussten. Nur die kleine Glocke im kleinen Turm hat alles überstanden.
Glockenweihe 1926
Nebst dem Pfarrer Riedel, der am 6. Juli 1749 in der Kirche beerdigt wurde, liegen noch ein Bürger aus Gießhübel, Zacharias Jarosch, und eine Frau Obst, die Frau des Richters Franz Obst, in der Kirche begraben. Nach 1945 verarmte unsere Kirche ganz und wird nun seelsorgerisch von Neu Hradek betreut. Im Zeitalter der Zünfte standen auch in unserer Kirche vier Zunftfahnen, im Hauptschiff vor der "Säulenbank". Als im Jahre 1904 sich die Zünfte auflösten und eine Handwerkergenossenschaft gegründet wurde, wurden auch die vier Fahnen aus der Kirche entfernt und eine Genossenschaftsfahne in der Mitte der Kirche bei der letzten Bank der zweiten Bankreihe aufgestellt.
Das Schulwesen in der Gemeinde
Nach der Kirche machte die Schule der Gemeinde die größte Sorge. Die erste Volksschulklasse wurde um das Jahr 1700 errichtet. Der Grund dazu dürfte die Einführung der Leinenweberei in Gießhübel gewesen sein. Zur Weberei musste wenigstens einer in jedem Hause zählen, lesen und rechnen können. Wohl nur deshalb wurde eine Volksschulklasse im Hause Nr. 7 errichtet. Der erste Lehrer war ein Mathias Wondrejz, der 1696 geboren und 1772 gestorben ist. Er starb an Herzschlag. Er war einer jener fünf Familien, die zur Einführung der Leinenweberei nach Gießhübel gekommen waren. Schon zu seiner Lebzeit war sein Sohn Josef Wondrejz, geboren 1735, bis 1796 Lehrer in Gießhübel. Dieser unterrichtete im eigenen Haus Nr. 10 (später Nr. 14, Haus des Otto Steiner, dann Richter). Daraus kann man ersehen, dass dieser im eigenen Interesse den Einwohnern das Lesen, Schreiben und Rechnen beibringen wollte. Josef Wondrejz hatte einen Bruder, Prokop Wondrejz, welcher im Hause Nr. 11 (später Nr. 15, Scheftner) wohnte. 1786 kaufte die Gemeinde von diesem das Haus und baute daraus ein hölzernes Schulgebäude. Das war das erste Schulhaus von Gießhübel. Aber erst 1789 wurde das Schulhaus bezogen von einem Lehrer, Ignatz Rolletschek, der in Grießau bei Groß Auerschim 1769 geboren wurde und von 1786 bis 1839 Lehrer in Gießhübel war. Dieser Ignatz Rolletschek war auch durch 52 Jahre Chorregent von Gießhübel. Er starb am 2. Februar 1839. Dieser Ignatz Rolletschek war ein Bruder des Franz Rolletschek, der auch in Grießau bei Groß Auerschim 1765 geboren war, und 1782 bis 1783 als Lehrer nach Gießhübel kam, dann aber als Lehrer nach Sattel ging und später die "Schnappe" in Gießhübel kaufte. Er starb 1799.
Ignatz Rolletschek hatte einen Sohn, der auch Ignatz hieß und Kaplan und Feldkurator in Wien war. Dieser starb am 5. Januar 1885 und hinterließ der Gemeinde die so genannte Rolletschek-Stiftung. Der Zinsertrag betrug jährlich 352 Kronen. Bis 1918 erhielten Bürger von Gießhübel diesen Betrag als Spende. Was dann damit geschehen ist, blieb unbekannt. Vor Ignatz Rolletschek war von 1784 bis 1786 ein Dominik Weihrauch Lehrer von Gießhübel. Nach Rolletschek kam Josef Grulich, 1814 bis 1816, dann Josef Groll, 1816 bis 1817, Johann Matèna, 1817 bis 1819. Aber schon während dieser Zeit von 1813 bis 1866 war der Schwager von Ignatz Rolletschek, ein Anton Stonner, Lehrer von Gießhübel. Er war 1795 geboren und starb im Mai 1866.
Schon 1790, unter dem Lehrer Ignatz Rolletschek, waren 180 Schüler in der Volksschule eingeschrieben. 1800 waren es schon 210, 1810 sogar 225 und 1820 sogar schon 265 Schüler. Da die Schülerzahl ständig zunahm, verlangte 1841 der Kreishauptmann Hrdlicka den Bau einer neuen Schule. Da kein Geld vorhanden war, errichtete man zwei Klassen, eine in Nr. 7 und die andere in Nr. 11. Lehrer waren Anton Stonner und Anton Marik von 1843 bis 1862. Da beim Stadtbrande 1861 beide Klassen ausbrannten, wurde im Hause Nr. 2 in Untergießhübel, damals dem Rudolf Wondrejz gehörend, der Unterricht halbtags weitergelehrt.
247 Schüler waren eingeschrieben. Da hier aber bald der Unterrichtsraum zu klein war, verlegte man am 1. Juni 1862 die Schule in das Haus Nr. 15, damals einem Josef Friemel gehörend, und zahle 110 Gulden Miete jährlich. Hier war Anton Stonner Lehrer und Wenzel Antonin Hilfslehrer. Das Haus aber wurde bald an Anton Stwrtetschka verkauft, welcher der erste gewählte Bürgermeister von Gießhübel war. Die Klassen wurden verlegt, eine in Nr. 8, dem heutigen Postamt, die zweite in das wieder aufgebaute Rathaus.
1867 wurde von der Gemeinde die Brandstelle Nr. 12 für 700 Gulden gekauft und der Bau einer Schule beschlossen. Im Herbst 1867 wurde noch der Grund gegraben und am 2. Juli 1868 der Grundstein gelegt. Am 21. September 1870 wurde die Schule eingeweiht. Gebaut wurde sie von einem Maurermeister Josef Hoffmann aus Lewin. Die Festrede bei der Einweihung hielt Albin Wondrejz als stellvertretender Bürgermeister und Obmann des Ortsschulrates. Die Volksschule war zweiklassig. Nach dem Gesetz vom 14. Mai 1869 mussten alle Kinder zur Schule gehen und so stieg die Schülerzahl ständig. Bereits am 1. Mai 1874 wurde im neuen Schulgebäude eine dritte Klasse eröffnet. Da aber bald mehr als 300 eingeschriebene Schüler waren, wurde eine vierte Klasse eröffnet. Das neue Schulgebäude wurde aber da schon zu klein und 1880 wurde ein neuer Teil nach hinten angebaut und am 16. Mai 1880 eröffnet. Im Schuljahr 1883/84 waren bereits 449 Schüler, so dass am 1. Januar 1884 bereits die fünfte Klasse bewilligt und eröffnet wurde. 1884 wurde zur Hofseite ein neuer Flügel mit zwei Lehrzimmern angebaut. Am 16. September 1884 hatte die fünfte Klasse bereits ein eigenes Lehrzimmer. Ein Jahr später, 1885, wurde die Klasse in Jungen und Mädchen geteilt. Am 16. August 1889 wurde für die kleinsten Kinder eine Expositur in Obergießhübel im Hause Nr. 33 bewilligt und am 1. November 1889 eröffnet. Ein Lehrer lehrte abwechselnd drei Tage in der Stadt und drei Tage in Obergießhübel. Am 16. Juni 1919 musste die Volksschule ein Lehrzimmer an Tschechen abgeben. Durch Anordnung wurde die Volksschule am 1. Dezember 1919 nur vierklassig, am 1. Juli 1922 nur dreiklassig und am 1. September 1924 nur zweiklassig. Am 1. Juli 1927 wurde wieder eine dritte Klasse bewilligt. Am 1. September 1927 wurde ein Kindergarten für 34 Kinder bewilligt.
Am 12. Februar 1904 beschloss der Amtsschulrat den Bau einer Knabenbürgerschule. Am 5. Mai 1905 wurde dazu der Grundstein gelegt. Am 16. September 1905 wurde die erste Klasse mit 52 Schülern im Hause Nr. 113 (zuletzt Veit Gerber) eröffnet. Am 9. September 1906 wurde das neue Gebäude eingeweiht. Am 16. September 1906 wurde der erste Unterricht im neuen Gebäude mit drei Jahrgängen eröffnet. Im Schuljahr 1912/13 wurden versuchsweise die ersten Mädchen aufgenommen. Am 3. Juli 1924 wurde sie zur gemischten Bürgerschule erklärt.
Seit dem Bestehen der Volksschule in Gießhübel sind nachstehende Lehrer bekannt:
Mathias Wondrejz bis 1772 geb. 1669 gest. 1772
Josef Wondrejz 1772 bis 1796 geb. 1725 gest. 1809
Franz Rolletschek 1782 bis 1783 geb. 1765 gest. 1799
Dominik Weihrauch 1784 bis 1786
Ignatz Rolletschek 1786 bis 1839 geb. 1769 gest. 1839
Josef Grulich 1814 bis 1816
Josef Groll 1816 bis 1817
Josef Matèna 1817 bis 1819
Anton Stonner 1813 bis 1866 geb. 1795 gest. 1866
Johann Novotny 1833 bis 1838
Alois Jirzak 1838 bis 1843
Anton Marik 1843 bis 1862
Wenzel Antonin 1862 bis 1863
Ignatz Sipsky 1864 bis 1866 entlassen am 16.1.1866
Josef Schmidt 1866 bis 1867
Johann Fischer bis 1866 später nach Sattel
Franz Brandejs 1867 bis 1868
Johann Obst 1866 bis 1876
Fidelus Stonner 1868 bis 1873
Johann Moschnitschka 1868 bis 1873
Isidor Neffe 1870 später Bürgerschuldirektor in Wien
Adolf Kriegler 1870 bis 1877
Josef Kasper 1873 bis 1876
Josef Brazda 1873 bis 1881
Franz Netuschil 1877 bis 1882
Emma Felzmann 1877 bis 1885 Handarbeitslehrerin
Karl Nafunek 1877 bis 1878
Josef Lachs 1879 bis 1880, dann nach Sattel
Leopold Dumek 1879 bis 1919, gest. 19.11.1931
Franz Novak 1880 bis 1920 gest. 1946
Franz Jenischta 1883 bis 1906 Lehrer und Oberlehrer
1906 bis 1918 Fachlehrer, dann Bürgerschuldirektor in Rokitnitz
Franz Radetzky 1889 bis 1895 gest. 1906 in Gießhübel
Beatrice Mayer 1889 bis 1892 verehelichte Jenischta
Rudolf Rubant 1891 bis 1899 Lehrer, dann
1920 bis 1921 Bürgerschuldirektor, gest. 1921
in Gießhübel
Edmund Baumetter 1892 bis 1919 gest. 1928 in Gießhübel
Mathilde Eimann 1895 bis 1900 verehelichte Rubant
Klementine Hoffmann 1885 bis 1901 verehelichte Stwrtetschka
Rudolf Finger 1899 bis 1904, dann
1917 bis 1945, gest. am 21. 2. 1946
Rosa Baumetter 1901 bis 1927 Handarbeitslehrerin
Edmund Hamacek 1905 bis 1920 Bürgerschuldirektor in Gießhübel
Wilhelm Hofmann 1906 bis 1929 Fachlehrer, dann
1923 bis 1939 Direktor in Gießhübel
Wilhelmine Radetzky 1907 bis 1917
verehelichte Stonjek,
gest. in Gießhübel
Roman Werner 1907 bis 1912 Fachlehrer
Rudolf
Knoblich 1912 bis 1913 Lehrer,
1918 bis 1939 Fachlehrer, 1939 bis 1945
Schulrat
Margarete Novak 1914 bis 1925 verehelichte
Knoblich,
gest. in Schönberg (Mecklenburg)
Marie Hamacek 1917 bis 1922
Wilhelm Dietrich 1920 bis 1929
Sebastian Schindler 1921 bis 1943 Fachlehrer
1943 bis 1945 Bürgerschuldirektor in Gießhübel
Marie Raabe 1925 bis 1939 Fachlehrerin,
gest. 27.10.1951 in
Königshofen, in Großeibstadt beerdigt
Erna Ohnheiser 1927 bis 1940 Industrielehrerin
Selma Ohnheiser 1927 bis 1940 Lehrerin
Neben diesem Lehrkörper gab es noch einige Lehrpersonen, die aber nur kurze Zeit in Gießhübel gelehrt haben. Mit der Abgabe eines Lehrzimmers am 16. September 1919 an die Tschechen erfolgte die erste Gründung einer tschechischen Schule in Gießhübel. Aber schon 1922 erfolgte der Bau einer neuen tschechischen Schule gegenüber der Bürgerschule, nachdem Herr Plodek sein Haus an die Tschechen verkauft hatte.
Die Gemeindeverwaltung
Neben der Kirche und der Schule waren die besten Männer von Gießhübel in der Gemeindeverwaltung zu finden. Seit der Erstürmung der Hummelburg durch Peter Polak, bis zur Gefangennahme des letzten Raubritters dieser Burg, Siegmund von Kaufungen, am 24. Mai 1534 war in Gießhübel eine herrenlose, schwere Zeit. Mit der Gefangennahme des letzten Raubritters war ein Mathäus von Schultheis nach Gießhübel gekommen, welcher hier auch Ordnung schaffte und zum Richter von Gießhübel ernannt wurde. In seine Gerichtsbarkeit von 1542 bis 1598 fällt auch der Bau der zweiten Kirche und die Anschaffung der größten Glocken, die Gießhübel je hatte. Jedoch nach seiner Zeit, ungefähr von 1600 bis 1700, war wieder für Gießhübel eine schwere Zeit. Der Dreißigjährige Krieg, der Durchzug der Schweden 1639 und die Annektierung der Grafschaft Glatz durch die Preußen, brachte Gießhübel schwere, herrenlose Zeiten. Nur als Trtschka sich der Frimburg und des Hammerhofes bemächtigt hatte, ernannte er einen seiner Knechte, den evangelischen Georg Hofmann, für die Zeit von 1640 bis 1651 zum Richter von Gießhübel. Doch nach der Vertreibung Trtschkas war auch Gießhübel wieder ohne Richter. Erst als fünf Familien zur Einführung der Leinenweberei nach Gießhübel gekommen sind, finden wir um 1700 einen dieser Männer, den Johann Stonjek, schon als Richter von Gießhübel. Ihm folgte von 1704 bis 1725 ein Daniel Hieronymus Stonner, dem das Wohl der Gemeinde besonders am Herzen lag. Er war Oberrichter und hatte einen Richter und fünf Ratsmänner als Beisitzer. Unter seiner Führung und der Vermittlung des Grafen Coloredo auf Opocno erhielt Gießhübel von Kaiser Josef I. die Bewilligung, jährlich drei Jahrmärkte abzuhalten. Nach einer Urkunde im Archiv zu Opocno erhielt das Städtchen eigene Gerichtsbarkeit und das Recht, einen Pranger aufzustellen. Dieser Galgen wurde unweit der Frimburg, dem heutigen Städtchen Neu Hradek, auf einem Berge aufgestellt. Heute noch heißt dieser Berg, der "Galgenberg". Aus der Aufstellung dieses Galgens bei der Frimburg ist zu ersehen, dass das ganze Gebiet der ehemaligen Frimburg zu Gießhübel und ihrer Gerichtsbarkeit gehörte. Hieromymus Stonner und seinen Nachfolgern gelang es auch die Ortsbewohner gegen Zahlung von jährlich 400 Gulden von der schuldigen Robott zu befreien, laut einer Urkunde von 15. Juli 1788. Dem Hieronymus Stonner folgten nachstehende Richter:
David Utz 1727 bis 1737
Matej Wondrejz 1760
Franz Obst 1767 bis 1787
Ignatz Herzig 1787 bis 1795
Hermann Obst 1804 bis 1806
Josef Novotny 1818 bis 1839
Franz Martinec 1840 bis 1841
Gabriel Stonjek 1843 bis 1850
Anton Stwrtetschka 1850 bis 1858
Anton Stwrtetschka war frei gewählter
Bürgermeister von Gießhübel. Nach 1858 wurde der Hausbesitzer
M. Friemel zum Bürgermeister gewählt, welcher
aber größtenteils schon von seinem Nachfolger Albin Wondrejz vertreten wurde,
welcher von 1885 bis 1905 gewählter Bürgermeister von Gießhübel wurde. Von 1905
bis 1921 war der Handelsmann Wendelin Nöttig Bürgermeister von Gießhübel.
Ihm folgten: Franz Jirku 1921 bis 1928
Wilhelm Hoffmann 1928 bis 1933
Rudolf Finger 1933 bis 1936
Josef Wolf 1936 bis 1939
Josef Schmoranz 1939 bis 1944
Anton Kluger 1944 bis 1945
Im Mai 1945 übernahm der tschechische Narodni Vybor die Gemeinde.
Der beste Bürger Gießhübels: Oskar
Migula
Wenn wir auch zweifellos sehr gute Männer in der Gemeindeverwaltung von Gießhübel finden, kommt der beste Bürger doch nicht zum Vorschein, Oskar Migula. Wohl leitete er während der Enthebung des Bürgermeisters Albin Wondrejz als erster Stadtrat die Gemeinde, doch verstand er es, seine Arbeit nicht an die große Glocke zu hängen. Oskar Migula war als Zwillingskind am 16. Dezember 1838 zu Bruch in Pr. Schlesien geboren. Die Schule besuchte er zu Neumarkt. Nach dem frühen Tode seines Vaters und durch Vermittlung seines Onkels erlernte er mit 16 Jahren zu Schomberg bei Beuthen das Brauhandwerk. Am 10. Juni 1856 wurde es als Brauer freigesprochen. Mit dieser Zeit begannen seine Wanderjahre. Vom 15. Oktober 1856 bis 1. August 1857 finden wir ihn in der Brauerei Mauschner in Posen. 1857, 1858 und 1859 arbeitete er Ruhla, von 1859 bis 10. Juli 1862 in Schwechart bei Wien und 1864 im kaiserlichen Hofbräuhaus in Graudensdorf bei Wien. Nach dem 1. März 1864 finden wir Oskar in leitender Stellung in Hohenbruck bei Königgrätz bis zum 3. Dezember 1866. Als Preuße wurde er im Kriegsjahr 1866 interniert, jedoch bald nach der Schlacht bei Königgrätz wieder freigelassen. Der Gedanke, einmal eine eigene Brauerei zu besitzen, führte ihn nach Dobruka. Hier arbeitete er als Pächter in Companie mit einem Herrn Crek. Von hier aus lernte er Gießhübel kennen und schon 1869 gründete er eine Gesellschaft O. Migula & Co. zum Zwecke der Erbauung und Inbetriebnahme eines Brauhauses in Gießhübel.
Brauerei Migula
Im August 1869 wurde mit dem Bau begonnen und im Februar 1870 gelangte schon das erste Bier zum Ausschank. Da er ein sehr guter Fachmann seiner Zeit war, floss bald Bier aus Gießhübel bis Nachod, Hronov, Dobruka, Neustadt, ja sogar in die Grafschaft Glatz. 1894 hatte sich Migula schon soweit emporgearbeitet, dass er alleiniger Inhaber des Gesellschaftsbetriebes wurde. Als geborener Preuße nahm er 1870 das österreichische Bürgerrecht an und wurde Bürger Gießhübels. 1871 heiratete er eine angesehene Müllerstochter, mit welcher er bis in sein hohes Alter glücklich war. Er starb in Gießhübel am 7. April 1929 im hohen Alter von 91 Jahren.
Oskar Migula war nicht nur ein tüchtiger Geschäftsmann seines Gewerbes, sondern auch hervorragend als Ortsschulinspektor, als Obmann des landwirtschaftlichen Bezirksvereins, aber auch ein wahrer Freund des Gesanges und guter Musik. Er war auch ein guter Gesellschafter und ein wahrer Freund des Deutschtums.
Nach dem Bau der Brauerei hatte Migula bald neue Baupläne. Er baute gar bald ein Wohnhaus Nr. 94, um 1904 ein Gasthaus in Untergießhübel "Im Grünen Tal", er finanzierte auch den Bau eines Gasthauses in Rokoli, sicherte sich vertraglich den Ausschank seines Bieres, was aber nach der Gründung der Tschechoslowakei 1918 auf wiederholtes Drängen der Tschechen ungültig gemacht werden musste.
Gasthaus "Im Grünen Tal"
Am 14. Juni 1910 erwarb Oskar Migula mit seinem ältesten Sohn, Erdmann Migula, das Grundstück Nr. 81 vom Verkäufer Josef Stonner zum Kaufpreis von 19.600.- Kronen. Aus dieser Mehlmühle (man nannte sie die Hackaufmühle) baute Migula ein Elektrizitätswerk. Bereits 1910 hatte der Ort Gießhübel durch den Fortschritt Oskar Migulas elektrisches Licht. Leider hatte die Bevölkerung nicht den richtigen Sinn dafür, so dass es später, als Migula verkauft hatte, zu einer ungünstigen Entwicklung kam.
Zentrale (Elektrizitäts- u- Sägewerk)
Als die Russen 1945 auch in Gießhübel eindrangen, wurde auch die Brauerei Oskar Migulas demontiert, und alles, Maschinen, Fässer und Flaschen nach Russland verfrachtet. So endete das Werk eines großen Mannes, dem er sein Leben gewidmet hatte.


Ehemalige Brauerei Migula,
verfallen und abgerissen im Herbst 2004
Die Post und ihre Postmeister
Wenn es auch um 1900 noch viele Analphabeten in Gießhübel hatte, wurde um 1850 doch schon eine Poststelle errichtet. Der zum Briefträger ernannte Stjepa trug die Post täglich von Gießhübel nach Neustadt an der Mettau und brachte die Post von dort mit und verteilte sie in Gießhübel. Als Postmeister war um 1900 ein gewisser Hoffmann angestellt. Aber schon 1906 wurde in Gießhübel ein Post- und Telegraphenamt errichtet. Am Ringplatz, im Hause des Herrn Petzelt, später Ulrich, wurde der Verkaufsladen durch eine Mauer in zwei Räume geteilt und im kleinen Raum das Post- und Telegraphenamt untergebracht. Neben Postmeister Hoffmann war Julie Novak als Postfräulein angestellt. Hoffmann erreichte 1915 die Altersgrenze und ein Herr Parsche wurde als Postmeister angestellt. Da Parsche im ersten Weltkrieg zum Kriegsdienst eingezogen worden war, machte Hoffmann freiwillig bis 1918 Dienst. Wenn Gießhübel schon 1906 ein Post- und Telegraphenamt hatte, so erhielt es 1910 auch ein Telefonamt. Neben dieser öffentlichen Fernsprechstelle im Postamt war vor allem die Gemeindeverwaltung an das Telefonnetz angeschlossen, auch das Hotel "Jirku", das Bräuhaus und die Weberei Soumar mit zwei Anschlüssen. Weitere Anschlüsse kamen erst nach dem ersten Weltkrieg. Bald aber erwies sich der Raum der Unterbringung als zu klein und schon 1920 wurde unter Postmeister Parsche das Amt in den Narodni Dum verlegt, wenig später aber auch schon wieder von hier auf den Ringplatz zurück, ins Haus Nr. 8, wo es heute noch ist. Während Stjepa nach 1850 die Post von Neustadt holte und verteilte, so wurde 1895 eine Postkutsche bewilligt, welche Wendelin Zeuner kutschierte. Er fuhr früh um 7:00 Uhr nach Neustadt und kam nachmittags zurück. Während des ersten Weltkrieges kam noch täglich ein Bote von Neu Hradek früh mit der Post nach Gießhübel, also war zweimal Postzustellung im Orte. 1920 wurde ein Autobus zur Postbeförderung angeschafft, der zweimal täglich die Strecke fuhr. Diese Anschaffung hielt sich bis 1938. Als der Briefträger Stjepa um 1890 erkrankte, verteilte sein Sohn die Post weiter. 1908 wurde ein zweiter Briefträger in Gießhübel bewilligt und eingestellt. Es war Anton Stonner. Dieser verteilte die Post in Ober- und Untergießhübel, während Stjepa die Post in der Stadt zustellte. Die Post wurde zweimal täglich zugestellt. Stjepa wurde 1918 pensioniert und der Tscheche ottola trat an seine Stelle. Als Stonner 1933 auch pensioniert wurde, kam ein zweiter Tscheche, Jelinek, als Briefträger nach Gießhübel. Auch Postmeister Parsche wurde 1933 versetzt und der Tscheche Drana kam an seine Stelle. Diese drei Tschechen machten den Dienst bis zum 10. Oktober 1938, wo die Deutsche Post diese Poststelle übernahm. Aus dem Post- und Telegraphenamt wurde nur eine Poststelle. Diese leitete Emil Schramm, während Alois Kossek und Franz Wondrejz die Post zustellten. Da 1939 bereits der zweite Weltkrieg ausbrach, machten andere Hilfskräfte auch Dienst auf der Post. 1945 übernahmen Tschechen wieder die Post, Stovicek wurde Postmeister und Hanel Briefträger.
Geschichten von der Erlenmühle
Niemals wird wohl die Schönheit dieses Alscherbaches, die blühenden Wiesen, die blauen Berge und das klare Wasser dieses Baches, von den einstigen Bewohnern dieses herrlichen Tales, die es 1946 verlassen mussten, vergessen werden. Die Wenigsten denken heute noch an jene Menschen, die einst mit uns dieses herrliche Tal bewohnten und deren Namen noch heute eng damit verbunden sind. Viele von ihnen machten damals Geschichte, Heimatgeschichte, die allen noch in Erinnerung sein müsste.
Wer aber denkt heute noch an die Erlenmühle und deren Besitzer? Wer kennt noch die dunkle Geschichte dieser Mühle? Ich habe meinen Teil dieser Geschichte selbst erlebt und möchte sie daher allen meinen ehemaligen Heimatfreunden in Erinnerung bringen.
Es war an einem Märztag des Jahres 1913. Ich war 16 Jahre alt und hatte meine Arbeit mit gutem Verdienst. Mein bester Freund war wohl damals unseres Nachbarn Sohn, der Franz, der übrigens im ersten Weltkrieg gefallen ist und ungefähr acht Jahre älter war als ich. An dem genannten Märztag kam Franz in mein Vaterhaus und erzählte ganz aufgeregt, dass es ihn in der letzten Nacht bei der Erlenmühle geschreckt hat. Er erzählte uns dann sein Erlebnis:
"Ich ging so in der zwölften Nachtstunde von meiner Leni nach Hause. Ich wählte den Weg über die Wiesen zur Straße und musste so bei der Erlenmühle vorbeigehen. Die bleiche Sichel des Mondes stand am wolkenlosen Himmel und leichter Frost legte sich auf die Erde. Als ich schon bei der Mühle vorbei war, merkte ich, dass der Ziegenbock des Erlenmüllers auf dessen Misthaufen stand. Mein erster Gedanke war, dass der Erlenmüller den Ziegenbock abends zum Einstallen vergessen haben musste. Ich trug mich mit dem Gedanken, den Müller zu wecken. Doch dann dachte ich, dass vielleicht die Stalltür offen ist und der Ziegenbock so den Stall verlassen konnte. Ich entschloss mich, nachzusehen, und ging auf den Ziegenbock zu, der so an die 20 bis 25 Meter von mir entfernt war. Als ich schon bis auf fünf Schritte an den Ziegenbock herangekommen war, war der plötzlich vor meinen Augen verschwunden. Ich blieb stehen, sah mich überall um, aber nichts war zu sehen. Ich ging zur Stalltür, um zu sehen, ob diese offen sei. Doch sie war fest verschlossen. Jetzt erst kam mir der Gedanke es hat gespukt. Ich fühlte, wie meine Haare zu Berge stiegen, ich lief den Seitenweg schnell weiter und hatte nur den einen Gedanken schnell weg."
Alle Anwesenden, die diese Geschichte gehört hatten, lachten herzlich und hänselten den Erzähler, nicht so lange bei seiner Leni zu bleiben. Nur einer wurde ernster, unser Nachbar, ein alter Schuster, von dem ich schon manche Geschichte gehört hatte und der nun seinerseits zu erzählen begann, was uns alle aufhorchen ließ.
So begann der Schuster zu erzählen: "Es soll an einem Spätherbsttage gewesen sein. Der Erlenmüller saß am Tisch, auf dem ein kleines Rapsöllicht brannte und zählte die Gold- und Silberstücke, die er in einem Strumpf immer unter seinem Kopfkissen aufbewahrt hatte. Da klopfte es an die verschlossene Haustür. Der Erlenmüller sagte zu seiner Frau: "Mutter, geh` mal schauen, wer noch so spät zu uns kommt!". Die Frau öffnete die Tür und in die Stube trat ein Handwerksbursche, der den Müller um ein Essen und ein Nachtlager bat. "Schlafen kannst du hier auf der Bank", soll der Müller gesagt haben, "aber Essen kann ich dir keines geben, denn mir fressen die Ratten das ganze Brot". Der Handwerksbursche sagte: "Meister, da könnt` ich euch helfen. Wenn ihr mir morgen bei Tage zeigt, wo die Ratten nisten, dann werde ich versuchen, sie zu vertreiben". "Wenn du das im Stande bist" sagte der Müller, "dann sollst du das ganze Gold und Silber haben, das in diesem Strumpfe ist". "Abgemacht", sagte nun der Handwerksbursche. Da befahl nun der Müller: "Mutter, gib` dem Manne Suppe und Brot und morgen wollen wir sehen". Der Handwerksbursche bekam nun reichlich Essen und legte sich dann auf die Bank zum Schlafen.
Am nächsten Morgen, als der Handwerksbursche wieder gegessen hatte und es langsam Tag wurde, ließ er sich die Rattenlöcher zeigen und machte sich dann an die Arbeit. Als kurze Zeit später nicht nur der Müller und seine Frau, sondern auch andere Menschen die Rattenabwanderung aus der Mühle sahen, stiegen ihnen die Haare zu Berge. Die Ratten liefen den Weg entlang und verschwanden in den Feldern. Der Handwerksbursche hatte ganze Arbeit geleistet. Aber dann soll es geschehen sein. Der Handwerksbursche verlangte nun das Gold und Silber aus dem Strumpfe, wie abgemacht. Aber von dem wollte sich der Müller nicht trennen. Wohl blieb die Wahrheit ein Geheimnis, aber die Leute erzählten sich, dass der Müller den Handwerksburschen in die finstere Bankstube gelockt hat und ihn dort erschlagen haben soll. Am Straßenrande oberhalb der Mühle soll er ihn dann vergraben haben. Die Seele aber dieses Unschuldigen sucht nach Recht und Gerechtigkeit, bis das Verbrechen gesühnt ist. So kann es sein, dass sie durch einen Spuk die Menschen auf jene Tat aufmerksam machen will."
Nach dem Märztage, an dem ich dieses Furchtbare erfahren habe, kam der Frühling ins Land und schon standen Hocken reifen Getreides auf den Feldern. Man schrieb den 17. August 1913. An diesem Tage, also am Vorabend des 83. Geburtstages von Kaiser Franz Josef, gab unsere Musikkapelle ein Ständchen. Wie heute war es auch schon damals, wo die Musik spielte, war auch die Jugend. Auch ich war zugegen und als alles gegen 9:00 Uhr abends zu Ende war, traf ich einen Arbeitskollegen, mit welchem ich in das Gasthaus "Zu den 14 Arschbacken" auf ein Glas Bier ging. Hier fand sich bald ein dritter Kollege ein und es war bald geschehen, Spielkarten lagen auf dem Tisch und wir spielten. Nur eine Stunde hieß es, aber als wir aufbrachen war es doch schon in der zwölften Stunde zu Mitternacht. Die Hälfte des Weges legte ich mit meinen Arbeitskollegen zurück, dann aber musste ich allein gehen, und noch dazu bei der Erlenmühle vorbei.
Es war eine finstere Nacht. Nebelregen legte sich auf die Erde. Wenn ein leichter Windstoß durch die Bäume wehte, fielen schwere Regentropfen von den Blättern der Bäume zur Erde und plätscherten in den Pfützen. Sonst war es ganz still und meine Schritte dröhnten fast unheimlich durch die Nacht. Allerhand Gedanken gingen durch meinen Kopf und nicht zuletzt dachte ich daran, dass mir im Wagengleis, so hatte ich mal gehört, also mitten auf der Straße, nichts geschehen kann, wenn es mich auch schrecken würde. Ich hielt mich also schön mitten auf der Straße und ging guten Mutes weiter. Beim letzten Haus vor der Erlenmühle wurde es besonders unheimlich. Links neben der Straße plätscherte nun das Wasser im Mühlbach. Bäume und Sträucher entlang dieses Mühlbaches machten die Straße besonders finster. Rechts machten Kastanienbäume bei einer Marienstatue die Straße kaum sichtbar. Von den großen Lindenbäumen fielen schwere Regentropfen zur Erde, als plötzlich mein Fuß in der Dunkelheit auf etwas Weiches stieß. Jetzt erst sah ich vor mich auf die Straße und sah einen Hund von der Straße aufstehen, einen richtig großen Bernhardiner.
Ohne daran zu denken, wem der Hund gehören könnte oder wo er herkommen könnte, freute ich mich vielmehr, dass ich nicht allein bei der Erlenmühle vorbeigehen muss, sondern dass eben noch ein Hund mit mir geht und mir so nichts geschehen kann. Der Hund ging brav vor mir, auch wie ich, mitten auf der Straße. Als wir bereits bei der Erlenmühle vorbei waren, wurde es etwas heller auf der Straße, da links wie rechts nun keine Bäume oder Sträucher waren, so konnte ich meinen Hund gut bewundern, groß wie ein Kalb mit langem, starkem Haar. Mein Blick ging nun auch auf die Vorderseite der Mühle und ich konnte deutlich erkennen, dass in einem Fenster ein kleines Licht brannte und ich dachte bei mir, wenn der Müller noch wach ist, kann mir ja überhaupt nichts geschehen. Nun war ich ja wieder ganz froh und meine Gedanken hefteten sich an meinen Hund, wo er nun wohl hingehen wird, denn ich bin ja nun bald daheim und mitnehmen kann ich ihn doch nicht. Bei diesen Gedanken an meinen Hund war ich etwa 20 Meter von der Mühle weggekommen, stand also kurz vor dem nächsten Haus, als mein Hund vor meinen Augen spurlos verschwunden war. Ich blieb stehen, sah mich überall um, es war an dieser Stelle nicht so finster, aber kein Hund war mehr zu sehen. Jetzt erst kamen mir allerhand Gedanken, ich drehte mich noch einmal um, sah zur Mühle hin, das Licht im Fenster, das ich deutlich gesehen hatte, war auch weg.
Nun standen mir die Haare zu Berge und ich ging so schnell wie möglich nach Hause, aber nur mitten auf der Straße. Als ich nach wenigen Minuten in meinem Bett lag, fand ich keinen Schlaf, sondern musste immerzu an die Geschichte des Schusters denken, wie auch an mein Erlebnis. Wollte wirklich eine unsterbliche Seele mich auf etwas aufmerksam machen, auf ein Licht im Fenster? Diese Gedanken beschäftigten mich bis zum Morgengrauen, dann erst schlief ich ein, aber einen ruhigen Schlaf fand ich auch dann nicht. Auch mein Erlebnis brachte keine Klärung dieser Geschichte und falls wirklich ein Verbrechen dort einmal geschehen ist, blieb es ungesühnt.
Heute ist die Erlenmühle nicht mehr. Wer
kann sich noch an sie erinnern, wer weiß wie sie ausgesehen hat und wer der
letzte Erlenmüller war? Er war ein großer Geizhals. Als an einem 1. Mai die
Musikkapelle ihm ein Ständchen brachte gab er für zwölf Musiker einen Kreuzer.
"Bettelleuten gibt man das immer" meinte er lächelnd. Wenn ihn seine
Pflicht ins Gasthaus seines Nachbarn zu einem Ball zwang, dann trank er die
ganze Nacht nur ein Glas Bier. An einer Zigarre rauchte er die ganze Nacht.
Hänseleien seiner Mitmenschen konnten ihn nicht stören. Zur Kirche ging er nie.
Wenn am Frohnleichnamstage alle Menschen ihre besten Kleider anzogen und zur
Kirche eilten, nahm der Erlenmüller seine Sense auf die Schulter, ging in
seinen Garten und mähte das erste Gras zum Trocknen. Von seinen vier Kindern
blieben zwei im ersten Weltkrieg. Ein Sohn, der am Leben blieb, kannte zwar das
Geldausgeben aber nicht das Verdienen. Die Tochter hatte einen reichen Mann
geheiratet, aber bald schwand der Reichtum und auch ihr Mann blieb im ersten
Weltkrieg. Der Erlenmüller aber zeichnete sein ganzes Geld auf Kriegsanleihen,
die 5,5% Zinsen hatten es ihm angetan. Als sein jüngster Sohn gefallen war,
verkaufte er auch die Mühle an einen Tschechen, zeichnete auch dieses Geld in
Kriegsanleihen und als der Krieg ein ungewolltes Ende nahm, blieb dem Helden
unserer Geschichte nur noch ein Strick von seinem ganzen Reichtum, mit dem er
seinem Leben ein Ende machte.
Erinnerung an die Heimat
Die alte Heimat möcht´ ich wiederseh´n,
Die grünen Felder auf den Bergeshöh´n,
Die Seewaldshöh´ und auch den Rittersprung,
Die hab´ ich stets in der Erinnerung.
Die alte Heimat in dem Alschertale,
Mit bunten Blumen in dem Wiesensaale,
Die Kinzelmühle in dem Wiesengrund,
Die hab´ ich heut´ noch in Erinnerung.
Die alte Heimat, wie sie einstens blühte,
Die Cernymühle und die Herzlikschmiede,
Die schönen Mädchen in dem Turnerbund,
Die hab´ ich heut´ noch in Erinnerung.
Die alte Heimat und die Hohe Mense,
Den Stenkaberg zur Sommersonnenwende,
Die grünen Wälder auf den Bergen rund,
Die hab´ ich heut´ noch in Erinnerung.
Die alte Heimat möcht´ ich wiederseh´n,
Durch ihre Wälder möcht´ ich wieder geh´n,
Adlergebirge, hör´ aus meinem Mund,
Dich hab´ ich stets in der Erinnerung.













